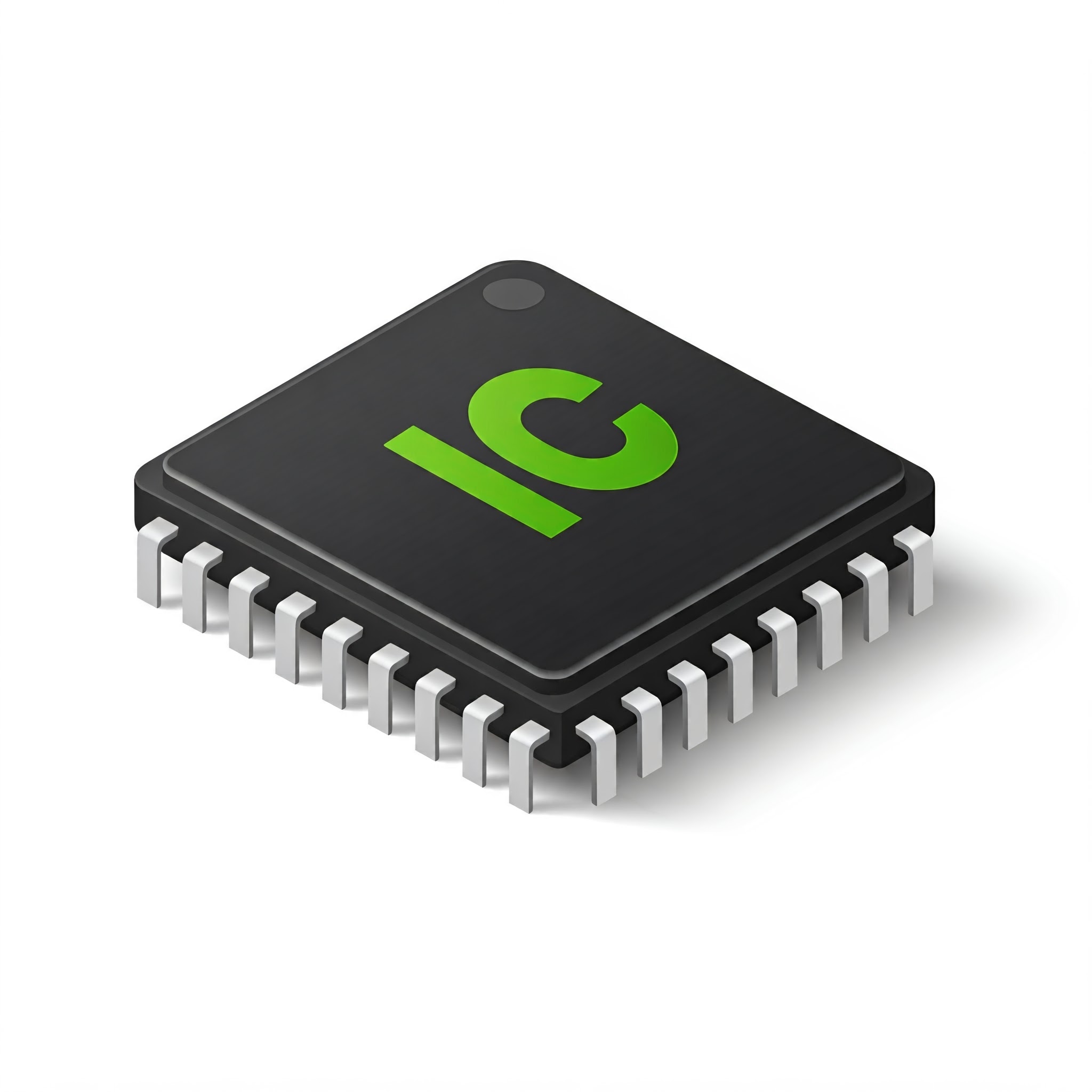Autoren: Lydia Petersmann, Raphael Parsiegel
Im Rahmen dieses Projekts konnte von Studierenden gezeigt werden, wie mit gängiger Technik des Amateurfunks Funkverbindungen zu Satelliten und Raumstationen aufgebaut werden können. Neben dem Empfang von Wettersatelliten und einem reaktivierten Militärsatelliten der US Air Force aus den sechziger Jahren mithilfe selbstgebauter Antennen, konnte eine Funkverbindung über die Internationale Raumstation (ISS) mit einem spanischen Funkamateur aufgebaut werden. Zusätzlich wurde eine Sende- und Empfangsstation für die Kommunikation über den geostationären Satelliten Es’hail 2 (QO-100) aufgebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurde ein Konzept aufgestellt, wie es in Zukunft möglich sein kann die Sende- und Empfangsantennen automatisiert in Richtung eines überfliegenden Satelliten auszurichten. Umgesetzt wurde dies an der Amateurfunkstation DK0WH in der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Bereits wenige Jahre nachdem der erste Satellit überhaupt in eine Erdumlaufbahn gebracht wurde, folgte mit dem OSCAR 1 der erste Amateurfunksatellit. Seitdem wurden über 100 Amateurfunksatelliten, meist als Sekundärlast anderer Raummissionen, gestartet. Häufig sind diese mit Relaisstationen ausgestattet und bewegen sich – abgesehen vom Es’hail 2 (QO-100), dem ersten und einzigen geostationären Amateurfunksatelliten – in einigen hundert Kilometern Höhe um die Erde und ermöglichen so Funkamateuren auf der ganzen Welt miteinander zu kommunizieren. Da jedoch eine Sichtverbindung nötig ist, ist die Reichweite meist auf einige Hundert Kilometer beschränkt. Neben Sprechfunk, ist so u.a. CW-Telegrafie (Morsen), Bildübertragung per SSTV und Packet Radio möglich. Genutzt wird meist das 2-Meter- oder das 70-Zentimeterband. Je nach Leistung und Frequenz des Satelliten kann es außerdem notwendig sein, eine nachführbare Richtantenne zu nutzen. In vielen Fällen ist jedoch eine feste Rundstrahlantenne ausreichend. [2]